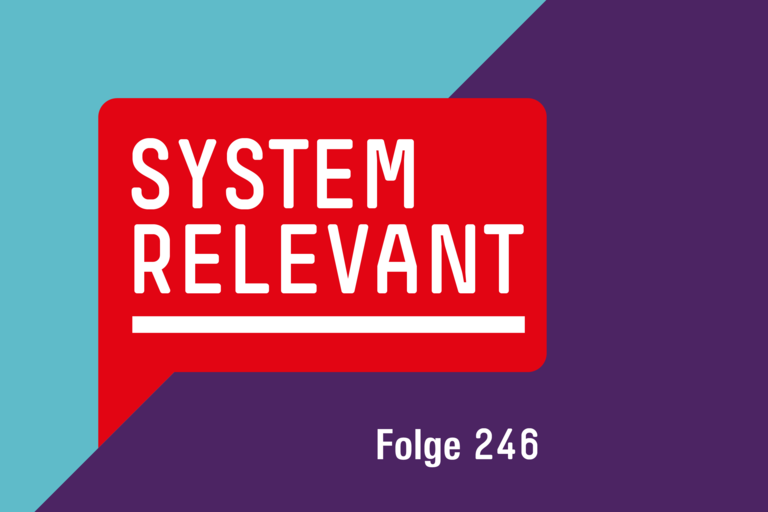Quelle: Photoshot
Silke Bothfeld/Peter Bleses, 21.10.2025: Gleichstellung im Arbeitsmarkt: Herausforderungen der sozial-ökologischen Transformation
Um die sozial-ökologische Transformation geschlechtergerecht auszugestalten, muss eine Strategie des Ausbaus von Dienstleistungen mit besseren Arbeitsbedingungen verbunden werden.
Der Arbeitsmarkt ist einer der Dreh- und Angelpunkte für das Gelingen einer (geschlechter-)gerechten ökologischen Transformation. Neben den großen Fragen, wie wir unseren Ressourcen- und Energieverbrauch neu justieren können, müssen wir auch Lösungen entwickeln, wie wir die Folgen dieses – nach der Mechanisierung, Industrialisierung und der Automatisierung und Digitalisierung erneuten – strukturellen Wandels des Arbeitsmarkts gestalten wollen. Im Sachverständigengutachten zum Vierten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung (Sachverständigenkommission 2025) haben wir die Folgen der sozial-ökologischen Transformation für das Geschlechterverhältnis im deutschen Arbeitsmarkt untersucht. Unsere Erkenntnis: Wollen wir Gleichheit und Gerechtigkeit stärken, müssen wir sehr viel ‚tiefer‘ ansetzen, als wir uns bislang vorgestellt haben.
Die sozial-ökologische Transformation geschlechtergerecht gestalten – eine doppelte Herausforderung
Die sozial-ökologische Transformation ist eine doppelte Herausforderung: Zum einen ist der ökologische Umbau insgesamt zu bewerkstelligen, zum anderen muss dieser Umbau sozial gerecht ausgestaltet werden – die Geschlechtergerechtigkeit ist dabei eine zentrale Dimension. In der Bewältigung dieser doppelten Herausforderung bildet der Arbeitsmarkt einen zentralen Koordinationsmechanismus, der über die Verteilung des Volkseinkommens zwischen Wirtschaft und Arbeitnehmenden und zwischen Sektoren, Branchen und den verschiedenen Beschäftigtengruppen entscheidet. Dass eine ‚unsichtbare Hand‘ über die Löhne als den ‚Preis der Arbeit‘ die gesellschaftlichen und individuellen Bedarfe und die Bereitstellung von notwendigen Gütern und die Sicherung menschlicher Existenz in akzeptabler Weise regeln könnte, gehört ja seit langem ins Reich der Mythen. Eine ungeregelte fortschreitende Transformation droht die Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt zu verstärken. Obwohl sich die Erwerbsbeteiligung von Frauen in den letzten Jahrzehnten erhöht hat, bestehen deutliche Unterschiede zu Männern fort – sowohl in der Arbeitszeitgestaltung als auch in der beruflichen Position und den Einkommen. Sorge- und Familienarbeit ist weiterhin ungleich verteilt, was während der COVID-19-Pandemie besonders deutlich wurde. Frauen arbeiten noch immer überproportional häufig in Teilzeit und in Berufen mit geringeren Einkommen, was zu einer anhaltenden Lohn- und Rentenlücke führt – es ist vor allem die Segregation im Arbeitsmarkt, die zur Verfestigung der Unterschiede geführt hat (Jochmann-Döll 2024; Haan et al. 2025).
Darüber hinaus stellt die Anerkennung der planetaren Grenzen unser bisheriges Denken vom Kopf auf die Füße: Wie auch die Industrialisierung, deren wichtigste gesellschaftliche Folge die Entwicklung des Sozialstaats war, geht es bei der sozial-ökologischen Transformation um eine systematische Einhegung und nicht zuerst um eine Unterstützung der Marktprozesse. Zielte die Entwicklung des Sozialstaats auf den Schutz der Ressource Arbeitskraft, zielt das sozial-ökologische Transformationsprojekt darauf, die natürlichen Grundlagen des menschlichen Lebens auf diesem Planeten – Raum, Zeit und Rohstoffe – dem zu weitgehenden Marktzugriff zu entziehen. Angesichts der planetaren Grenzen kann nur noch gelten: Nicht, was denkbar ist, kann gemacht werden, sondern was machbar ist, muss gedacht (und umgesetzt) werden! Daher muss der Hauptantrieb technologischer Entwicklung – die private Gewinnerzielung – durch die Logik des gemeinwohlorientierten und nachhaltigen Handelns bei Konsum und Produktion flankiert, wenn nicht ersetzt werden. Der Idee der unbegrenzten Möglichkeiten von Produktentwicklung und -vermarktung müssen Lösungen für suffiziente Wirtschaftsweisen des ‚Genug‘ gegenübergestellt und deren Umsetzung betrieben werden.
Das allein wäre schon schwierig genug – wie etwa die Verabschiedung des Verbrenners in der Automobilindustrie oder die Umstellung auf die Kreislaufwirtschaft zeigen. Besonders komplex ist das Projekt der sozial-ökologischen Transformation aber, weil die alte ‚fordistische‘ Industriegesellschaft strukturell auf Ungleichheit und Ungerechtigkeit – inklusive der gesellschaftlichen Arbeitsteilung – aufbaut. Sie ‚funktioniert‘ nur durch Inkaufnahme sozialer Ungleichheit und einer geschlechterspezifischen Arbeitsteilung. ‚Nur einfach‘ nachhaltige Produkt- und Produktionsstrategien einzuführen, würde Ungerechtigkeiten und Ungleichheit perpetuieren, vermutlich sogar vergrößern, wenn die Beschäftigungschancen gering qualifizierter Arbeitskräfte weiter sinken und die Segregation im Arbeitsmarkt wächst. Die Zunahme sozialer Ungleichheit und die empfundene Bedrohung des gewohnten Lebensstandards würde den sozialen Zusammenhalt, der schon jetzt brüchig geworden ist, zusätzlichem Stress aussetzen.
Zwar stellt die Stärkung von sozialer Gleichheit und Gerechtigkeit die bisherigen Verteilungsmuster, gesellschaftlichen Verhältnisse und unsere kulturellen Gewohnheiten teilweise in Frage. Allerdings ist eine gezielte Politik einer gerechten Transformation steuer- und dosierbar – etwa durch eine deutlichere Benennung und Kommunikation der Vorteile und Gewinne einer geschlechtergerechten und nachhaltigen Lebensweise und eine ‚kontrollierte‘ Vergabe von (sozial-)investiven Mitteln etwa durch Umwelt- oder Klimaverträglichkeitsprüfungen und Gender-Checks. Und vermutlich gilt auch – und darin liegt eine große Chance –, dass die Zurückdrängung des Verwertungszwangs menschlicher Arbeitskraft Räume für die selbstverantwortete Gestaltung des eigenen Lebens schaffen kann. Das handfeste Ziel aller Akteure, die sich für gute und nachhaltige Erwerbsarbeit einsetzen, ist dabei die Eröffnung von menschlichen Entwicklungschancen etwa durch die Entwicklung der eigenen Qualifikationen oder einer umweltbewussteren Lebensweise oder die geschlechtergerechte Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie.
Die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt
Die Veränderungen werden daher auch im Arbeitsmarkt, ja in der Volkswirtschaft insgesamt grundlegend und nicht nur ‚kosmetischer‘ Art sein müssen (s. a. Bothfeld 2026). Der Umbau ganzer Branchen, die für die Reduzierung der CO2-Emissionen zentral sind (Energie, Mobilität, Wohnen und Ernährung), und die inhaltliche Veränderung der Berufe sind bereits im Gange. Die vorhandenen gleichstellungspolitischen Instrumente – gezielte Anwerbung von Frauen in die technischen Berufe, die Ermutigung zum beruflichen Aufstieg, die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, der Gender-Check bei Maßnahmen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung und natürlich ein starkes Entgelttransparenzgesetz – sind notwendige Bedingungen, um die Gleichstellung im Arbeitsmarkt voranzubringen. Allerdings müssen sie noch konsequenter zur Anwendung gebracht werden, wenn Frauen und Männer die gleichen Chancen auf gute Beschäftigungsverhältnisse haben sollen.
Die neue Herausforderung für den Arbeitsmarkt und die Beschäftigung in der Transformation ist jedoch, dass sich die Grundzüge unseres Wirtschaftens auf allen Ebenen verändern (Froud et al. 2022). Ein verändertes Verständnis von Wirtschaft und Produktion, die Idee des Kreislaufs oder nachhaltiger Wirtschafts- und Lebensweisen wird auch das Verständnis dessen, was wir unter Arbeit verstehen, verändern. Zeitbedarfe für ‚Eigenarbeit‘ – im Garten, für Reparaturen, für die Familie oder die Selbstentfaltung oder Weiterbildung – werden möglicherweise größer, und damit auch der Wunsch nach kürzeren Erwerbsarbeitszeiten oder guten Rahmenbedingungen für Aktivitäten, die außerhalb der Erwerbsarbeit liegen. Kürzere Vollzeitnormen werden aber gerade Frauen eine höhere und gleichberechtigte Erwerbsteilnahme ermöglichen, so dass durch Arbeitszeitverkürzungen kein Mangel an Arbeitskräften entstehen wird.
Auf der anderen Seite wird es des tiefgreifenden strukturellen Wandels der Wirtschaft insgesamt bedürfen. Manche Industriezweige verlieren stark an Bedeutung, während der Dienstleistungssektor weiter expandiert. Industriearbeit bleibt zwar weiterhin wichtig – etwa die forschungsbasierte Industrie, Produktentwicklung und die Produktion systemrelevanter Güter wie Energie, Stahl, Maschinenbau, Lebensmittel und vieles mehr – und regional sehr ungleich verteilt (Südekum/Rademacher 2024). Auch das Handwerk besitzt für den Klimaschutz und die Klimaanpassung große Bedeutung. Der Dienstleistungssektor birgt aber bisher ungehobene Beschäftigungspotentiale (Voss et al. 2025).
Die zentrale Bedeutung der sozialen Dienstleistungen
Für das Gelingen der Transformation ist der Ausbau der sozialen und Gesundheitsdienstleistungen in der Pflege, Kinderbetreuung und Bildungsarbeit, die zum Kern der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge gehören – grundlegend. Das Konzept des vorsorgenden Wirtschaftens verweist schon seit langem auf die Notwendigkeit eines Umbaus unserer Volkswirtschaft (Biesecker 2003). Die sozialen Dienstleistungen werden – und das tun sie bereits in großem Umfang – neue Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. Und die ökologische Transformation wird den Weiterbildungsbedarf zusätzlich erhöhen und damit auch die Nachfrage nach Lehrkräften. Diese Sektoren sind heute zum überwiegenden Teil weiblich geprägt, aber gleichzeitig häufig durch niedrigere Lohnniveaus im Vergleich zur Industrie, höhere Teilzeitquoten und geringere gesellschaftliche Wertschätzung gekennzeichnet.
Die geringe Wertschätzung sozialer Dienstleistungen steht in krassem Missverhältnis zu ihrer gesellschaftlichen Bedeutung. Sie sind Teil der sozialen Arbeitsteilung insgesamt: Die öffentliche Bereitstellung wichtiger Dienstleistungen ermöglicht den Menschen, ihrer Erwerbsarbeit nachzugehen oder sich zu qualifizieren – ein Effekt, der sich seit der Expansion der Kinderbetreuung bereits zeigt. Erstens wachsen damit Beschäftigungschancen in den sozialen Berufen und bieten Frauen und zunehmend auch Männern gute Beschäftigungsmöglichkeiten; zweitens können damit auch in ländlichen Räumen attraktive Wohnregionen entwickelt werden, ohne dass die Menschen zur Abwanderung in die Städte gezwungen sind; und drittens, vor allem, ermöglichen diese Dienstleistungen Eltern die Fortsetzung ihrer Erwerbstätigkeit auch nach der Familiengründung. Und vor allem sichert, wie das Beispiel der Lausitz zeigt, eine flächendeckende Bereitstellung sozialer Dienstleistungen Gleichheit der Lebensverhältnisse in solchen Regionen, die vom Abbau alter Industriebranchen, insbesondere in den Kohle- und Stahlregionen, besonders betroffen sind. Damit ist der Dienstleistungssektor ein wichtiger Baustein zur Sicherung des sozialen Zusammenhalts in Deutschland.
Die Stärkung der sozialen Daseinsvorsorge geht gleichstellungspolitisch mit zentralen Gestaltungsanforderungen einher:
- Aufwertung sozialer und personenbezogener Dienstleistungen durch bessere Bezahlung, faire Arbeitsbedingungen und attraktivere Karrierewege
- Integration in Fachkräftestrategien, um dem sich abzeichnenden Personalmangel in diesen Sektoren entgegenzuwirken, wobei insbesondere auf gute Qualifizierungsangebote und -strategien für den hohen Anteil an Helfer*innen in den sozialen und gesundheitsbezogenen Dienstleistungen geachtet werden muss
- Berücksichtigung der Arbeitsrealität dieser Berufe bei der Planung von Transformationsmaßnahmen – etwa im Hinblick auf Digitalisierungs- und Klimaanpassungsprozesse.
Die arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischen Rahmenbedingungen müssen stimmen
Tarifbindung und betriebliche Mitbestimmung sind wichtige Hebel für mehr Gleichstellung und für das Gelingen der sozial-ökologischen Transformation zugleich. Tarifverträge und die betriebliche Mitbestimmung sichern nicht nur Mindeststandards, sie enthalten häufig auch Regelungen zur Arbeitszeitlänge und zur Arbeitszeitlage, zu Entgeltgruppen und Weiterbildung und vielem mehr, die geschlechtergerechte Strukturen fördern können.
Den positiven Effekt von Tarifverträgen kann man insbesondere auch im geringeren Gender Pay Gap in tarifgebundenen im Vergleich zu nicht tariflich gebundenen Unternehmen erkennen. Zudem können Tarifverträge wie auch Betriebsvereinbarungen Regelungen zum sozial-ökologischen Umbau von Betrieben enthalten, die Erwartungssicherheit bei Unternehmen und Beschäftigten in Übergangsphasen bieten können. Der rückläufigen Tarifbindung, besonders in frauendominierten Branchen wie Einzelhandel, Gastronomie oder Teilen der sozialen Dienstleistungen, sollte mit einer Vereinfachung der Allgemeinverbindlicherklärung, der Förderung von Branchentarifverträgen in bislang tarifschwachen Sektoren, einer wirksameren Umsetzung der Tariftreueregelungen in Bund und Ländern und der Aufnahme von gleichstellungsorientierten Regelungen in Tarifverhandlungen begegnet werden.
Zur Stärkung der betrieblichen Mitbestimmung als Rahmenbedingung für eine geschlechtergerechte sozial-ökologische Transformation sollten Betriebsratsgründungen, auch in kleinen Betrieben leichter gemacht, auf eine ausgewogenere Geschlechtervertretung in Mitbestimmungsgremien hingewirkt und Gleichstellungsziele und ökologische Umbauziele in Betriebsvereinbarungen aufgenommen werden.
Der gesetzliche Mindestlohn ist dabei eine wichtige Flankierung. Zwar kann er allein das Gender Pay Gap nicht schließen, da strukturelle Ursachen wie die geschlechtliche Verteilung von Teilzeitquoten, der Berufswahlsegregation und von Führungspositionen sehr ungleich zuungunsten von Frauen ausfallen. Aber der gesetzliche Mindestlohn hat dennoch insbesondere bei Frauen zu spürbaren Lohnsteigerungen geführt, da Frauen überproportional oft im Niedriglohnsektor tätig sind. Damit der Mindestlohn zu einer armutsfesten unteren Einkommensgrenze wird, ist eine regelmäßige und deutliche Anpassung des Mindestlohns dringend notwendig.
Und schließlich bleibt die Qualifizierung ein zentrales Instrument, um Frauen und Männer gleichermaßen für zukunftsfeste Beschäftigung zu befähigen, da Digitalisierung, Dekarbonisierung und das Entstehen neuer Tätigkeiten neue Anforderungen schaffen. Hier gilt es, die Angebote der beruflichen Weiterbildung an die Bedarfe von Teilzeitbeschäftigten und Personen mit Care-Verpflichtungen besser anzupassen, um eine höhere Inanspruchnahme von Frauen zu gewährleisten. Notwendig sind auch spezifische Qualifizierungsprogramme, um Frauen in Zukunftsberufe – etwa in erneuerbaren Energien, IT- und andere technische Dienstleistungen – zu bringen. Zudem ist auf eine ausreichende Förderung von Qualifizierung gerade für Geringverdienende zu achten, die insbesondere in Tätigkeitsbereichen mit geringen Qualifikationsvoraussetzungen beschäftigt sind. In der verstärkten Qualifizierung von Beschäftigten ohne Berufsabschlüsse liegt außerdem ein großes Potenzial zur Minderung des Fachkräftemangels gerade in den für die sozial-ökologische Transformation wichtigen Handwerksbereichen (Friemer/Bleses 2024).
Fazit
Diese Zusammenschau legt nahe: „Schwache Interessen“ sind vor allem durch „starke Institutionen“ am besten geschützt. Um die sozial-ökologische Transformation geschlechtergerecht auszugestalten, müssen die beschäftigungspolitischen Institutionen mit einer Strategie des gezielten Ausbaus von Dienstleistungen mit besseren Arbeitsbedingungen verbunden werden. Davon profitieren derzeit vor allem die vielen in diesen Sektoren beschäftigten Frauen, weil ihre Einkommen verbessert würden und weil die Expansion des Dienstleistungssektors kurz- und mittelfristig die Voraussetzungen für die Erwerbschancen von Frauen denen der Männer angleichen könnte. Eine gleichstellungspolitische Strategie muss aber darüber hinausgehen und die Arbeitsmarktsegregation dadurch vermindern, dass mehr Anreize geschaffen werden, Frauen für die berufliche Qualifizierung und Arbeitsplätze in Industrie, Handwerk und technischen Dienstleistungen zu gewinnen. Und umgekehrt müsste vermehrt um Männer für Tätigkeiten in den sozialen Dienstleistungen geworben werden. Insgesamt benötigen soziale Dienstleistungen eine gesellschaftliche und monetäre Aufwertung, um ihre zentralen Funktionen für die gesellschaftliche Reproduktion erfüllen zu können.
Eine Transformationsstrategie, die auf mehr soziale Gerechtigkeit und hierbei vor allem auch auf Geschlechtergerechtigkeit abzielt, verhilft der sozial-ökologischen Transformation letztlich zu einer sozialen Basis, die Raum für die Gestaltung neuer Lebens-, Wirtschafts- und Konsumweisen schafft. Ein konstruktives Narrativ einer ökologischen Transformation, das auf positive gesellschaftspolitische Ziele ausgerichtet ist, wäre geeignet, aktuelle Abwehrreaktionen, Polemiken und Verlustängste produktiv zu überwinden.
Literatur
Biesecker, A. (2003): Vorsorgendes Wirtschaften — Wege zu einer nachhaltigen Ökonomie, in: Heinz, K./Thiessen, B. (Hrsg.): Feministische Forschung — Nachhaltige Einsprüche, Wiesbaden, S. 337–352
Bothfeld, S. (2026): Die Arbeit von Frauen in der sozial-ökologischen Transformation, in Bothfeld, S./Hohendanner, C./Schütt, P./Yollu-Tok, A. (Hrsg.): Geschlechtergerecht gestalten. Möglichkeiten und Grenzen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (i. E.), Wiesbaden
Friemer, A./Bleses, P. (2024): Geringqualifizierte Arbeitnehmer:innen im Ausbaugewerbe im Land Bremen: Qualifizierungsbedarfe und -strukturen. Arbeitnehmerkammer Bremen, Institut Arbeit und Wirtschaft, Reihe Arbeit und Wirtschaft in Bremen, Bd. 48, Bremen
Froud, J./Johal, S./Moran, M./Salento, A./Williams, K. (2022): Die Ökonomie des Alltagslebens: Für eine neue Infrastrukturpolitik, Wiesbaden (Erstausgabe 2018: Foundational Economy: The Infrastructure of Everyday Life, Manchester)
Haan, P./Kreyenfeld, M./Schmauck, S./Mika, T. (2025): Rentenansprüche von Frauen bleiben mit steigender Kinderzahl deutlich hinter denen von Männern zurück, in: DIW Wochenbericht 12/2025, Berlin
Jochmann-Döll, A. (2024): Entgeltgleichheit – Wege zum Ziel. Hans Böckler Stiftung: Working Paper Nr. 356, Düsseldorf
Sachverständigenkommission für den Vierten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung (2025): Geichstellung in der sozial-ökologischen Transformation. Gutachten für den Vierten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, Bundesstiftung Gleichstellung, Berlin
Südekum, J./Rademacher, P. (2024): Regionale Disparitäten in der Transformation. Empirische Evidenz und Implikationen für die Regionalpolitik, hrsg. Bertelsmann Stiftung, Gütersloh
Voss, D./Alwang, L./Yollu-Tok, A. (2025): Dienstleistungen in der sozial-ökologischen Transformation. Neue Chancen für mehr Geschlechtergerechtigkeit? Expertise für den Vierten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, Bundesstiftung Gleichstellung, Berlin
Die Blogserie ist eine Zusammenarbeit zwischen dem WSI und dem Next Economy Lab (NELA). Das WSI-Herbstforum 2025 hat sich unter dem Titel „Krisen, Kämpfe, Lösungen: Transformationskonflikte im sozial-ökologischen Wandel“ dem Thema ebenfalls gewidmet. Bei NELA entsteht diese Reihe im Rahmen des Projektes „Team soziale Klimawende“, in dem Gewerkschaftsmitglieder aus IG Metall, IG BCE und ver.di in einer übergewerkschaftlichen Fortbildungsreihe zu Transformationspromotor*innen ausgebildet werden. Das Projekt wird von der Mercator Stiftung unterstützt.
Die Beiträge der Serie
- Neva Löw/Sarah Mewes/Magdalena Polloczek: Konflikte um eine sozial gerechte Klimawende (08.10.2025)
- Markus Wissen: Transformationskonflikte und globale Klimagerechtigkeit (09.10.2025)
- Neva Löw/Maximilian Pichl: Wie Klimakrise und globale Migration miteinander verbunden sind (13.10.2025)
- Silke Bothfeld/Peter Bleses: Gleichstellung im Arbeitsmarkt – Welche Herausforderungen bringt die ökologische Transformation? (21.10.2025)
- Marischa Fast/Stefanie Bühn/Johanna Weis: Gesundheitsschutz im Kontext der Klima- und Umweltkrisen – ein Thema für die Arbeitswelt (27.11.2025)
- Rahel Weier/Miriam Rehm/Neva Löw: Wie Gendereinstellungen Klimasorgen prägen (29.01.2026)
weitere Beiträge in Vorbereitung
Zurück zum WSI-Blog Work on Progress
Autor*innen
Silke Bothfeld ist Professorin für Politikmanagement an der Hochschule Bremen. Sie war Sprecherin der Sachverständigenkommission für den Vierten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der vergleichenden Wohlfahrtsstaatforschung sowie im Bereich der Arbeitsmarkt- und der Gleichstellungspolitik.
Dr. Peter Bleses ist Leiter der Abteilung „Perspektiven nachhaltiger Beschäftigungsfähigkeit" am Institut Arbeit und Wirtschaft (iaw) der Universität Bremen und der Arbeitnehmerkammer Bremen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der praxisbezogenen Arbeitsforschung mit besonderer Berücksichtigung der sozialen Dienstleistungen.