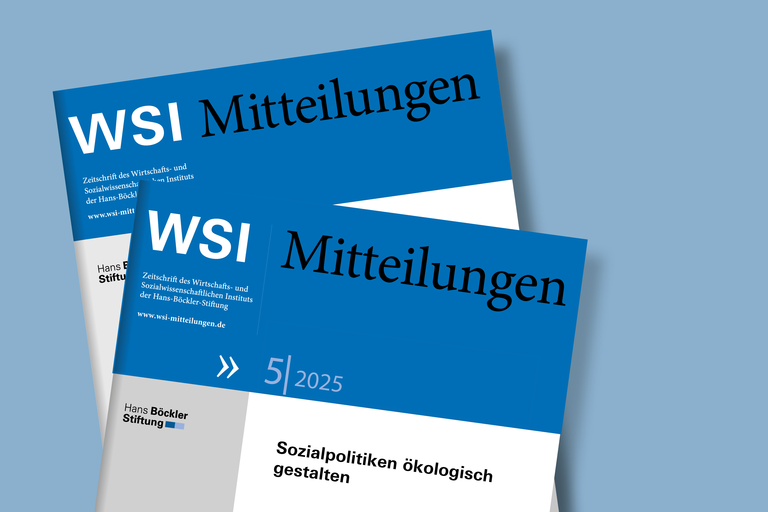Quelle: SZ Photo
Markus Wissen, 09.10.2025: Transformationskonflikte und globale Klimagerechtigkeit
Angesichts sich zuspitzender Krisen brauchen wir ein starkes Verständnis von just transition, das eine Demokratisierung der Ökonomie beinhaltet und die sozial-ökologische Transformation aus einer internationalistischen Perspektive denkt.
In den gegenwärtigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um das Ob und Wie einer sozial-ökologischen Transformation spielt die Gerechtigkeitsfrage eine zentrale Rolle: Wie sollen die Kosten für die Energiewende, vor allem für die dringend notwendigen Veränderungen im Gebäude- und Wärmesektor, verteilt werden? Wie lässt sich gewährleisten, dass eine Reduktion der Automobilität nicht zu Lasten von Menschen in peripheren, nur unzureichend vom ÖPNV erschlossenen Regionen geht? Wie kann verhindert werden, dass der Übergang vom Verbrennungs- zum Elektromotor mit Massenentlassungen bei Autoherstellern und Zuliefererbetrieben einhergeht? Das sind nur einige der Fragen, die sich aus einer Klimagerechtigkeitsperspektive stellen.
Von Seiten der Gewerkschaften werden sie nicht selten mit dem Konzept der just transition beantwortet. Demnach ist der Übergang in eine klimafreundliche, post-fossile Gesellschaft so zu gestalten, dass niemand dabei zurückbleibt. Die sozialen und ökonomischen Kosten, die sowohl der Kampf gegen die Klimakrise als auch die Anpassung an ihre nicht mehr vermeidbaren Folgen verursachen, sollen nicht primär von den Lohnabhängigen und ärmeren Teilen der Gesellschaft getragen werden.
Dies zu fordern, ist aus drei Gründen wichtig. Erstens beinhaltet das Konzept der just transition die Einsicht, dass die Verantwortung für die Klimakrise höchst ungleich verteilt ist. Es sind die Reichen in Gestalt der Vermögens- und Kapitalbesitzer*innen sowie der Bezieher*innen hoher Einkommen, die durch ihr Investitions- und Konsumverhalten überproportional hohe CO2-Emissionen verursachen. Die Forschung zu climate inequality hat dies hinreichend belegt (Chancel u.a. 2023).
Zweitens verweist die Forderung nach einer just transition darauf, dass es nicht damit getan ist, wenn alle „den Gürtel enger schnallen“. Viele können das einfach nicht, weil der Gürtel jetzt schon so eng sitzt, dass ihnen kaum noch Luft zum Atmen bleibt. Zudem verschiebt die Gürtel-Metapher das Problem in die Konsumsphäre und blendet aus, dass die entscheidenden Ursachen der Klimakrise in der gesellschaftlichen Organisation der Produktion zu finden sind.
Drittens schließlich ist eine gerechte Gestaltung des Übergangs wesentlich für die Akzeptanz von Klimapolitik. Das haben unter anderem die Gelbwesten-Proteste 2018 in Frankreich gezeigt. Sie richteten sich gegen eine vom Staat geplante Ökosteuer, die die berufliche Zwangsautomobilität von Lohnabhängigen in ländlichen Regionen erheblich verteuert hätte, ohne öffentliche und umweltfreundliche Alternativen zu schaffen. Die Reichen mit ihren erdzerstörerischen Praktiken wären dagegen weitgehend ungeschoren davongekommen (vgl. Schaupp 2021). Genau dagegen wendet sich das just-transition-Konzept, indem es die ökologische Frage mit der der sozialen Gerechtigkeit verbindet.
Fallstricke der just-transition-Debatte
Trotz dieser Verdienste läuft die Debatte über just transition im globalen Norden Gefahr, in Fallstricke zu geraten bzw. Verkürzungen aufzusitzen. Das ist dann der Fall, wenn das Problem vor allem im Übergang in eine post-fossile Gesellschaft gesehen wird, weniger dagegen in der Klimakrise und den sie hervorbringenden Mechanismen selbst. Eine solche Sichtweise ist einerseits durchaus nachvollziehbar. Sie liegt letztlich darin begründet, dass die kapitalistische Produktionsweise den meisten Menschen keine andere Wahl lässt, als ihre Arbeitskraft auf dem Markt zu verkaufen, und zwar auch für Zwecke, die, wie etwa die Produktion von Autos und Rüstungsgütern, der Natur sowie Menschen andernorts und in der Zukunft Schaden zufügen.
Dazu kommt, dass große Teile der Arbeiter*innenklasse im globalen Norden infolge vergangener Kämpfe um gesellschaftliche Teilhabe auch lebensweltlich von ressourcen- und emissionsintensiven Konsummustern und Infrastrukturen abhängen: Sie benötigen ein Auto, um zur Arbeit zu kommen, für das Heizen ihrer Wohnung brauchen sie Öl oder Gas, und in puncto Ernährung sind sie auf die Produkte einer industriellen Land- und Lebensmittelwirtschaft angewiesen. Die Abhängigkeit von fossilen Ressourcen hat sich folglich in den beruflichen und lebensweltlichen Alltag der Lohnabhängigen eingeschrieben und lässt diesen oft keine andere Wahl, als auf Kosten anderer und der Natur zu leben. Ulrich Brand und ich haben das als „imperiale Lebensweise“ bezeichnet (Brand/Wissen 2017). Das Eingebundensein in diese macht den Übergang in eine nachhaltigere Gesellschaft für viele in der Tat zu einem Problem.
Andererseits ist es jedoch verkürzt, das Problem vor allem im Übergang und weniger im sozial-ökologisch zerstörerischen Status quo kapitalistischer Gesellschaften zu sehen (vgl. Barca 2012; Räthzel/Uzzell 2011). Das gilt einmal im Hinblick auf die Lohnabhängigen im globalen Norden selbst: Nicht zuletzt aufgrund jahrzehntelanger neoliberaler Politiken leiden Arbeiter*innen in der Autoindustrie, im ÖPNV, im Gesundheitssektor und in vielen anderen Bereichen unter Arbeitsverdichtung, Unsicherheit, gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen, ständig zunehmenden Aufgaben, Entfremdung, mangelnder Anerkennung und/oder schlechter Bezahlung. Zudem bekommen sie die Folgen der Klimakrise früher und stärker zu spüren als die Angehörigen der oberen Klassen, etwa in Form von Hitze am Arbeitsplatz oder in schlecht isolierten Wohnungen (Brand et al. 2022). So gesehen haben gerade Arbeiter*innen von einer Überwindung des Status quo einiges zu gewinnen.
Das gilt erst recht, wenn der globale Süden in die Betrachtung mit einbezogen, wenn also die Frage der just transition internationalisiert wird. Die ressourcen- und emissionsintensive imperiale Lebensweise verursacht seit langem unermessliches Leid. Die (neo)kolonialen Nord-Süd-Beziehungen, auf denen sie beruht und die sie normalisiert, beinhalteten und beinhalten Sklaverei, Ausbeutung, Krankheit und millionenfachen Tod – aber auch vielfältigen Widerstand, basierend auf einem „weltumspannenden Klassenbewusstsein“ der Subalternen (Linebaugh/Rediker 2022: 160). In Zeiten der Klimakrise verschärft sich der Gegensatz zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden. Die Klassenunterschiede in der Verantwortung für die Krise und in der Betroffenheit von ihren Folgen, wie sie sich durch nahezu alle Gesellschaften ziehen, nehmen zusätzlich eine räumliche Gestalt an, und zwar insofern, als die Subalternen des globalen Südens, die wegen ihrer niedrigen CO2-Emissionen die geringste Verantwortung für die Krise tragen, am stärksten von deren Folgen betroffen sind.
Die im globalen Norden angestrebte ökologische Modernisierung macht die Sache nicht besser. Im Gegenteil, denn die dafür benötigten Ressourcen – Lithium, Kobalt und Nickel für die Batterien von Elektroautos oder grüner Wasserstoff für die Dekarbonisierung der Stahlindustrie – kommen zum großen Teil aus dem globalen Süden. Ihre Extraktion bzw. Herstellung zeitigt nicht selten verheerende sozial-ökologische Folgen (Schlosser/Wissen 2025). Das bedeutet: Selbst wenn der Übergang zu einer post-fossilen Gesellschaft aus Sicht der Lohnabhängigen in Europa gerecht gestaltet wird, kann er im globalen Maßstab neue Ungerechtigkeiten hervorrufen.
Christos Zografos fragt daher zurecht, was „auf der gegenüberliegenden Seite der Dinge“ passiert: „Was sind die Gerechtigkeitsimplikationen einer just transition jenseits der Grenzen der großen Volkswirtschaften, die eine Dekarbonisierung anstreben? Und wie steht es um die Gerechtigkeit für die Räume, die von den grünen Lösungen in Europa in Mitleidenschaft gezogen werden, und nicht nur um die Gerechtigkeit für jene, die in Europa von der Stilllegung schmutziger Industrien betroffen sind?“ (Zografos 2022: 40; Übers. M.W.)
Transformationskonflikte zuspitzen und internationalisieren
Was folgt daraus nun politisch? Dazu drei aufeinander aufbauende Bemerkungen: Erstens gilt es zu betonen, dass das Festhalten am Status quo keine Option ist. Lange sah es danach aus, als würde sich diese Einsicht unter dem Eindruck der Klimabewegung auch in bürgerlichen und sozialdemokratischen Kreisen und den meist von ihnen besetzten staatlichen Apparaten durchsetzen. Dafür sprachen etwa Programme wie der European Green Deal oder der Inflation Reduction Act in den USA. Seit einiger Zeit stellt sich das anders dar: Statt einer ökologischen Modernisierung erleben wir einen fossilen backlash (Zeller 2023), rechte Klimaleugner gewinnen Oberwasser, und die so genannte politische Mitte ist auf einen friedens- wie klimapolitisch fatalen Rüstungskurs eingeschwenkt.
Dem gilt es sich zu widersetzen. Und dabei sind gerade auch die Gewerkschaften gefordert. Sie sollten nicht den Verlockungen der Rüstungsindustrie erliegen, die kriselnde Betriebe der Metallbranche mit Arbeitsplatzversprechen zu ködern versucht. Die Umstellung der Produktion von Schienenfahrzeugen auf Panzer, wie sie sich derzeit bei Alstom in Görlitz ereignet, ist keine alternativlose Strategie des Arbeitsplatzerhalts. Schon gar nicht ist sie sozial-ökologisch oder sicherheitspolitisch wünschenswert: Sie steigert die Unsicherheit, indem sie geopolitische Spannungen verschärft und den sozialen Sicherungssystemen materielle Ressourcen entzieht. Gewerkschaften können dem entgegenwirken, indem sie dem bürgerlich-sozialdemokratischen Zeitgeist der Kriegstauglichkeit mit ihrem friedenspolitischen Auftrag begegnen. Nur so lassen sich die Voraussetzungen dafür wiederherstellen, sozial-ökologische Transformationskonflikte überhaupt erst führen und über den gerechten Übergang in eine post-fossile Gesellschaft streiten zu können.
Allerdings – so mein zweiter Punkt – sollten es Gewerkschaften und andere progressive Akteure wie die Klimabewegung nicht darauf anlegen, einfach zum Debattenstand zurückzukehren, wie er vor der Pandemie und dem Ukraine-Krieg schon einmal erreicht war. Der European Green Deal von 2019 enthält zwar einen Just-Transition-Mechanismus. Allerdings profitieren von diesem nur solche Territorien, Industrien und Beschäftigte, die innerhalb der EU nachteilig vom sozial-ökologischen Wandel betroffen sind. Dazu gehören etwa Bergbauregionen, in denen die EU Qualifizierungsmaßnahmen und Investitionen zugunsten einer umweltfreundlichen ökonomischen Diversifizierung unterstützt. Die Auswirkungen einer just transition in Europa auf den globalen Süden bleiben demgegenüber unberücksichtigt. Sie können jedoch gravierend sein und dürfen deshalb nicht einfach vernachlässigt werden. Ein Übergang, der Gerechtigkeit nur für europäische Arbeiter*innen anstrebt, ist ungerecht. Es bedarf der Internationalisierung von Transformationskonflikten und des Konzepts der just transition. Gewerkschaften können dazu einen Beitrag leisten, indem sie z.B. die Begegnung und den Erfahrungsaustausch von Beschäftigten entlang von Wertschöpfungsketten organisieren.
Drittens: In den kommenden Transformationskonflikten wäre statt des Übergangs viel stärker dessen Ausgangspunkt, also der sozial-ökologisch destruktive kapitalistische Status quo, zu problematisieren. Dieser sollte nicht länger als zwar ökologisch modernisierungsbedürftig, aber grundsätzlich bewahrenswert begriffen werden (affirmatives Verständnis von just transition), sondern als ein Zustand, dessen Überwindung im Interesse des Überlebens und des guten Lebens für alle heute und in der Zukunft keinen Aufschub mehr duldet (transformatives Verständnis von just transition).
Das klingt nach einer abstrakten Forderung, der es an jeglichem Realitätsbezug mangelt. Tatsächlich wird ihr aber bereits heute in vielen Transformationskonflikten Nachdruck verliehen. Das gilt etwa dort, wo Menschen kollektiv für den Ausbau von sozialen und technischen Infrastrukturen streiten und streiken und sich für bessere Arbeitsbedingungen der hier Beschäftigten einsetzen (#wirfahrenzusammen 2023), wo sie für ein alternatives, an den Prinzipien der Regionalität und Saisonalität orientiertes Ernährungssystem kämpfen (Redecker/Herzig 2020) und wo sie Ideen für eine progressive Konversion entwickeln, die nicht Schienenfahrzeuge durch Panzer, sondern Autos durch Busse, Straßenbahnen und Lastenräder ersetzt (Kaiser 2023; Ressel/Zachrau 2025; siehe auch die Initiative Verkehrswendestadt Wolfsburg sowie den Mobilitäts-Podcast von Katja Diehl).
Aus einer gewerkschaftlichen Perspektive sind diese Kämpfe außerordentlich attraktiv, denn es geht in ihnen um zusätzliche, gute und sozial-ökologisch sinnvolle Arbeitsplätze, die Menschen aus dem Zwiespalt befreien, sich auf Kosten anderer reproduzieren müssen. Nicht zuletzt ermöglichen sie Erfahrungen politischer, vor allem demokratischer Selbstwirksamkeit. Die Unterstützung und Orientierung solcher Kämpfe sowie ihre Zuspitzung auf eine als „elementare Transformationsressource“ zu begreifende „Demokratisierung des Ökonomischen“ hin (Urban 2025: 32) erfordern Konfliktfähigkeit und die Wahrnehmung eines starken politischen Mandats (vgl. Sweeney/Treat 2018). Organisationspolitische Widersprüche ebenso wie die Widersprüche in den Lebenslagen und Interessen der Beschäftigten verschwinden dadurch nicht einfach. Aber das tun sie auch nicht, wenn man sich auf die Verteidigung des Bestehenden konzentriert. In einer Zeit, in der es ums Ganze geht, brauchen wir den Mut, die Verhältnisse ebenso konkret wie grundsätzlich in Frage zu stellen und den Horizont des Möglichen zu erweitern.
Literatur
#wirfahrenzusammen (2023): Argumente für eine soziale und ökologische Verkehrswende, Berlin, https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Publ-Texte/Zahlen_und_Fakten_10-2023_online.pdf
Barca, Stefania (2012): On working-class environmentalism. A historical and transnational overview, in: Interface, 4(2), 61-80.
Brand, Ulrich/Fried, Barbara/Koch, Rhonda/Schurian, Hannah/Wissen, Markus (2022): Deiche bauen reicht nicht. Die Klimafolgen bringen massive soziale Verwerfungen mit sich. Die herrschende Politik wird das Problem nicht lösen, sondern eher verschärfen. Wir brauchen dringend Konzepte der Anpassung von links, in: LuXemburg, Heft 2, 32-41, https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/deiche-bauen-reicht-nicht/.
Brand, Ulrich/Wissen, Markus (2017): Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus, München.
Chancel, Lucas/Bothe, Philipp/Voituriez, Tancrède (2023): Climate inequality report 2023. Fair taxes for a sustainable future in the Global South. World Inequality Lab Study 2023/1, https://wid.world/wp-content/uploads/2023/01/CBV2023-ClimateInequalityReport-3.pdf (letzter Zugriff am 21.8.2025).
Kaiser, Julia (2023): Rückkehr der Konversionsbewegung? Potenziale und Grenzen der Konversionsbestrebungen sozial-ökologischer Bündnisse rund um Autozuliefererwerke, in: PROKLA 210, 53(1), 35-53. DOI: https://doi.org/10.32387/prokla.v53i210.2031.
Linebaugh, Peter/Rediker, Marcus (2022): Die vielköpfige Hydra. Die verborgene Geschichte des revolutionären Atlantiks, Berlin/Hamburg.
Räthzel, Nora/Uzzell, David (2011): Trade Unions and Climate Change. The Jobs versus Environment Dilemma in: Global Environmental Change, 21(4), 1215-1223. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.07.010.
Redecker, Sophie von/Herzig, Christian (2020): The Peasant Way of a More than Radical Democracy: The Case of La Via Campesina, in: Journal of Business Ethics, 164(4), 657-670. DOI: https://doi.org/10.1007/s10551-019-04402-6.
Ressel, Saida/Zachrau, Sebastian (2025): Konversion statt Kahlschlag: Wie Beschäftigte den Wandel in der Autoindustrie selbst gestalten, https://www.labournet.de/wp-content/uploads/2025/07/KonversionNela.pdf (letzter Zugriff am 21.8.2025).
Schaupp, Simon (2021): Das Ende des fossilen Klassenkompromisses. Die Gelbwestenbewegung als ökologischer Konflikt des „Hinterlands“, in: PROKLA 204, 51(3), 435-453. DOI: https://doi.org/10.32387/prokla.v51i204.1954.
Schlosser, Nina/Wissen, Markus (2025): Der Grüne Kapitalismus und sein Außen. Rohstoffkonflikte um die ökologische Modernisierung der Automobilität, in: Graduiertenkolleg „Krise und sozial-ökologische Transformation“ (Hg.): Kämpfe um Transformation. Kritische Analysen und Interventionen zur sozial-ökologischen Krise, Bielefeld, 33-48.
Sweeney, Sean/Treat, John (2018): Trade Unions and Just Transition. The Search for a Transformative Politics. TUED Working Paper No. 11, https://cdn.prod.website-files.com/63276dc4e6b803208bf159df/63405e3d59938f30fa6e67c9_TUED-WP11-Trade-Unions-and-Just-Transition.pdf (letzter Zugriff am 21.8.2025).
Urban, Hans-Jürgen (2025): Demokratie als Transformationsressource. Über Regression, Resilienz und Progression in der kapitalistischen Demokratie, in: Wannöffel, Manfred/Hoose, Fabian/Niewerth, Claudia/Urban, Hans-Jürgen (Hg.): Mitbestimmung und Partizipation 2030. Demokratische Perspektiven auf Arbeit und Beschäftigung, Baden-Baden, 31-47.
Zeller, Christian (2023): Fossile Gegenoffensive – Grüner Kapitalismus ist nicht in Sicht, in: Emanzipation. Zeitschrift für ökosozialistische Strategie, 7(2), 221-252.
Zografos, Christos (2022): The contradictions of Green New Deals: green sacrifice and colonialism, in: Soundings, (80), 37-50. DOI: https://doi.org/10.3898/SOUN.80.03.2022.
Die Blogserie ist eine Zusammenarbeit zwischen dem WSI und dem Next Economy Lab (NELA). Das WSI-Herbstforum 2025 hat sich unter dem Titel „Krisen, Kämpfe, Lösungen: Transformationskonflikte im sozial-ökologischen Wandel“ dem Thema ebenfalls gewidmet. Bei NELA entsteht diese Reihe im Rahmen des Projektes „Team soziale Klimawende“, in dem Gewerkschaftsmitglieder aus IG Metall, IG BCE und ver.di in einer übergewerkschaftlichen Fortbildungsreihe zu Transformationspromotor*innen ausgebildet werden. Das Projekt wird von der Mercator Stiftung unterstützt.
Die Beiträge der Serie
- Neva Löw/Sarah Mewes/Magdalena Polloczek: Konflikte um eine sozial gerechte Klimawende (08.10.2025)
- Markus Wissen: Transformationskonflikte und globale Klimagerechtigkeit (09.10.2025)
- Neva Löw/Maximilian Pichl: Wie Klimakrise und globale Migration miteinander verbunden sind (13.10.2025)
- Silke Bothfeld/Peter Bleses: Gleichstellung im Arbeitsmarkt – Welche Herausforderungen bringt die ökologische Transformation? (21.10.2025)
- Marischa Fast/Stefanie Bühn/Johanna Weis: Gesundheitsschutz im Kontext der Klima- und Umweltkrisen – ein Thema für die Arbeitswelt (27.11.2025)
- Rahel Weier/Miriam Rehm/Neva Löw: Wie Gendereinstellungen Klimasorgen prägen (29.01.2026)
weitere Beiträge in Vorbereitung
Zurück zum WSI-Blog Work on Progress
Autor
Prof. Dr. Markus Wissen lehrt und forscht an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin zu sozial-ökologischen Transformationsprozessen. Er leitet das von der Hans-Böckler-Stiftung finanzierte Projekt „Industriebeschäftigte in der Transformation. Dekarbonisierung als umkämpfte ökologische Modernisierung von Produktionsregimes“.