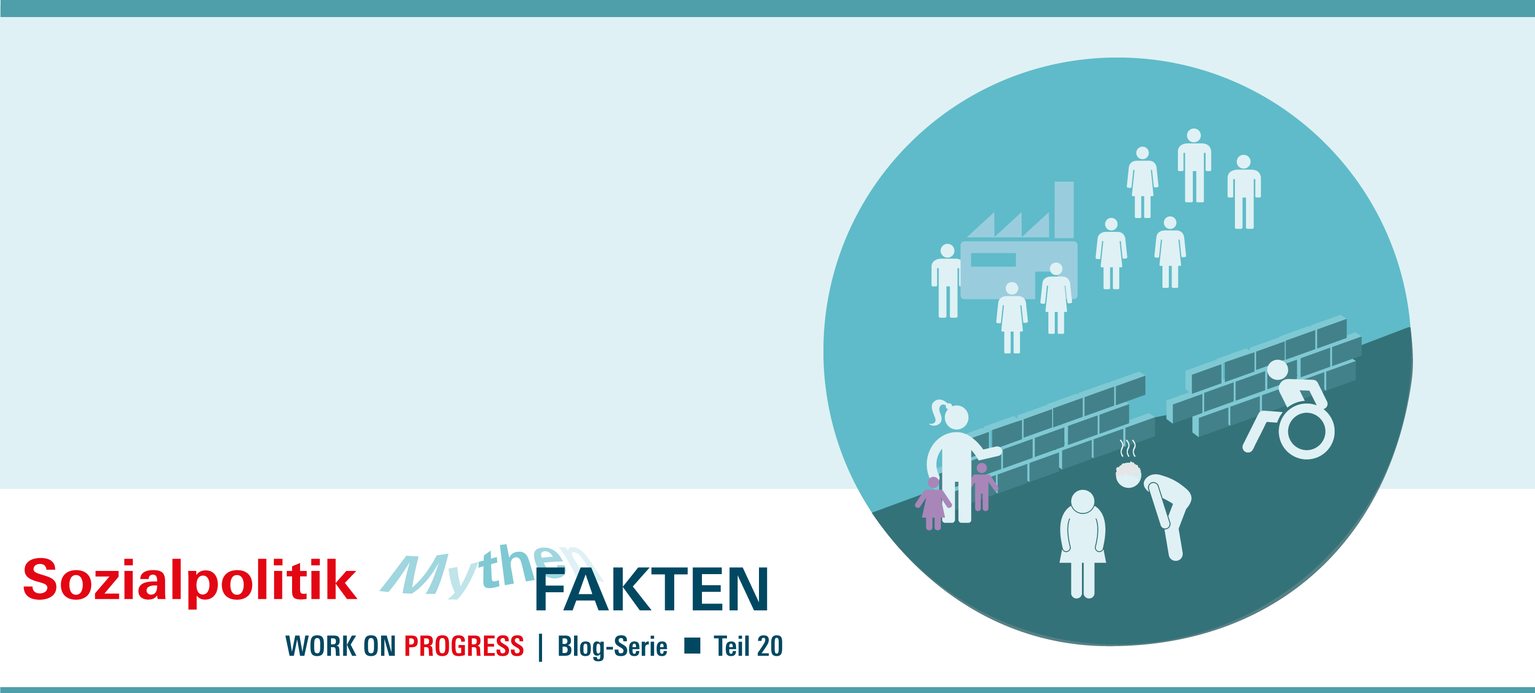
Quelle: WSI
Eike Windscheid-Profeta, 05.02.2026: Alt, krank, weiblich: Abwertung im Betrieb verhindert die Ausschöpfung von Erwerbspotenzialen
Die Erwerbsteilhabe, z.B. von Frauen und Müttern, soll ausgebaut werden, um Fachkräfte zu gewinnen und Wertschöpfung zu steigern. Statt Integration und Anerkennung erfahren diese Beschäftigten im Betrieb jedoch oft Abwertung und Diskriminierung.
Rufe nach mehr und längerer Erwerbsbeteiligung beherrschen derzeit politische Debatten um Arbeit und Sozialpolitik (siehe hier, hier und hier bereits an anderer Stelle im Blog). Mehr Arbeit soll Wirtschaftswachstum befördern und Fachkräftelücken schließen (siehe hier und auch bereits hier). Aktuelle politische Vorhaben zielen darauf ab, den Arbeitsumfang von Beschäftigten auszuweiten. Die dafür vorgesehenen Maßnahmen sind jedoch hoch selektiv: Zum einen adressieren und begünstigen sie vor allem Besserverdienende und Männer; zum anderen beeinträchtigen sie Gesundheit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das zeigen Analysen zu den von der Koalition avisierten Vorhaben wie etwa zu steuerlichen Anreizen für Mehrarbeit (siehe hier, hier und hier), zur sog. Aktivrente (siehe hier) oder zur pauschalen Ausweitung von Wochenarbeitszeiten (siehe hier).
Insofern ist es ein Mythos, dass mit solchen (aber auch weiteren, wie etwa hier pauschal geforderten) Maßnahmen große Beschäftigungsgewinne erreicht werden könnten – die oben genannten Analysen kommen zu dem Schluss, dass nur kleine oder allenfalls moderate Effekte erzielt werden können. Hinzu kommt, dass in Betrieben oft kein strategisches Diversitäts- und Inklusionsmanagement vorhanden ist, mithilfe dessen größere Erwerbspotenziale unterschiedlicher Gruppen längst aktivierbar wären (siehe z. B. hier) – und das auch ohne die neuen Maßnahmen. Entsprechend kann auch die Idee, (mehr) Arbeit über eine Anpassung von Transferentzugsraten attraktiver zu gestalten (wie im Bericht der Sozialstaatkommission vorgeschlagen, siehe hier) nur eine Seite der Medaille sein. Die andere Seite bilden die betrieblichen Arbeitsbedingungen, um die es hier gehen soll.
Denn ein Blick in die empirische Realität zeigt, wie wenig nach wie vor für Vielfalt und Inklusion in Betrieben getan wird und wie gering das Interesse daran ist, bestehende Erwerbspotenziale auszuschöpfen und Rahmenbedingungen zu schaffen, mit denen sie sich gewinnbringend erschließen lassen. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die für die Realisierung der Vorteile diverser Belegschaften notwendigen Investitionen gescheut werden: Es müssen Löhne angeglichen, Bewertungsmaßstäbe verändert und überhaupt lang eingelebte Organisationsroutinen umgestaltet werden (siehe hier, S. 16).
Zwar geben viele Unternehmen an, dass sie diverse Belegschaften für bereichernd und auch in Zukunft für besonders relevant halten (siehe z. B. hier oder hier). Jedoch haben sich Diversität und Gleichstellung in den Betrieben zuletzt rückläufig entwickelt (siehe z. B. hier zur Repräsentanz von Frauen in höheren Führungstätigkeiten). Und dort, wo Maßnahmen zur Förderung von Vielfalt im Unternehmen bestehen bzw. ergriffen werden, handelt es sich oftmals vor allem um Legitimationsfassaden (z. B. bei der Offenlegung und Beseitigung von geschlechterspezifischen Gehaltslücken, siehe hier).
Die sog. „Ideal Worker Norm“ – nach der umfassende und lange Verfügbarkeit sowie Bereitschaft zu Mehrarbeit am Arbeitsplatz besonders honoriert werden (was vornehmlich gesunde, mittelalte Männer leisten können, siehe hier) – hat sich offenkundig lange und bis heute stabil in Betriebs- und Arbeitswelten gehalten und bricht erst langsam auf (siehe hier). Darauf weisen auch die drei Beispiele, auf die in diesem Beitrag näher eingegangen wird, hin: (1) Frauen und Mütter, (2) ältere Beschäftigte und Ruheständler*innen sowie (3) leistungsgewandelte und (schwer-)behinderte Personen.* Die Beispiele illustrieren, dass vielerorts betriebliche Ungleichheitsregime bestehen, die anstelle von Vielfalt und Durchlässigkeit homogene Kernbelegschaften privilegieren.
Frauen und Mütter
Die Erhöhung weiblicher Erwerbsbeteiligung wird häufig als großes Potenzial beschrieben, um das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen auszuweiten (siehe z. B. hier). Gelänge es, Voraussetzungen zu schaffen, die zu einer erhöhten Arbeitsmarktteilhabe unter Frauen und Müttern führten – sei es in Form der Aufnahme von bzw. Rückkehr in Arbeit oder durch die Aufstockung von Arbeitsstunden – könnten in vielen Bereichen Fachkräftelücken geschlossen werden, so etwa in der Pflege (siehe z. B. hier).
In vielen Branchen und Betrieben treffen Frauen und insbesondere Mütter jedoch auf strukturelle Hemmnisse, u. a.:
- Ungleiche Bezahlung: Nicht nur in Bezug auf Lebenseinkommen, Alterssicherung und Vermögen bestehen zwischen Frauen – insbesondere Müttern – und Männern nach wie vor große Unterschiede (siehe z. B. hier); auch der Brutto-Stundenverdienst unterscheidet sich nicht unerheblich (siehe hier), was darauf hinweist, dass in vielen Tätigkeiten und Betrieben der Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ noch immer nicht umgesetzt ist (siehe hier). Trotz eindeutiger Gesetzeslage sind die Wege zur Entgeltgleichheit (im Betrieb) offenbar noch immer weit (siehe zusammenfassend auch hier).
- Hemmnisse beim Wiedereinstieg: Frauen sind besonders häufig mit Benachteiligung bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz nach Erwerbsunterbrechungen konfrontiert, insbesondere nach Mutterschaft und Elternzeit (siehe hier). Sie nehmen diese oft häufiger und länger in Anspruch als männliche Kollegen und antizipieren nicht selten bereits vor der Wiederkehr damit verknüpfte Reintegrationshemmnisse (siehe hier).
- Aufstiegsbarrieren und Karrierehürden: Verbreitet sind nicht nur geringe Anteile von Frauen in (höheren) Führungspositionen oder unerfüllte Quotenauflagen (siehe hier). Frauen werden auch bei Beförderungen und Karriereentscheidungen systematisch benachteiligt (siehe z. B. hier, hier und hier). Lange bekannt und gut dokumentiert sind außerdem dysfunktionale Drehtür-Effekte (siehe z. B. bereits hier) und gläserne Decken (siehe zusammenfassend hier).
- Verminderter Zugang zu Weiterbildung: Auch bei der individuellen Personalentwicklung sind Frauen häufiger benachteiligt, wie etwa mit Blick auf karriererelevante Outcomes von formellen Fort- und Weiterbildungen bzw. Chancen auf eine (zeitliche) Teilnahme hieran (siehe hier).
Daneben sind Frauen besonders häufig in „bad jobs“ beschäftigt, die prekär sind, etwa in Bezug auf weniger komplexe Arbeiten, Teilzeittätigkeit oder Minijobs etc. (siehe zusammenfassend hier). Hinzu kommen strukturelle Benachteiligungen jenseits der betrieblichen Arbeitsgestaltung, die zulasten von Frauen und Mütter gehen – dazu zählt vor allem die ungleiche partnerschaftliche Verteilung von Sorgearbeit (siehe hier, hier und hier). Und auch wenn gleiche Bezahlung, gleiche Aufstiegschancen etc. nicht automatisch zu einer Ausweitung von Arbeitsvolumen unter Frauen und Müttern führen, so bilden sie doch basale Voraussetzungen einer gleichberechtigten Erwerbsteilhabe, die ihnen überhaupt erst eine Entscheidung über Berufseintritte, -rückkehr bzw. Arbeitszeitaufstockung ermöglicht, anstatt sie in (unfreiwillige) Teilzeit zu drängen (siehe hier). Dafür kann in Betrieben viel getan werden, beispielsweise in Form von Angeboten für mehr Arbeitszeitzeitsouveränität (siehe hier) oder einer klug organisierten Kompensation von Abwesenheiten infolge der Inanspruchnahme gesetzlicher Zeitrechte (siehe hier).
Ältere Beschäftigte und Ruheständler*innen
Besonders stark diskutiert wurde zuletzt auch die Erwerbsbeteiligung älterer Personen, insbesondere ab 55 Jahren. Damit einher gehen Fragen nach verlängerten Lebensarbeitszeiten – mithin das Aufschieben von Renteneintritten – sowie Anreize für ein Weiterarbeiten nach dem Renteneintritt, etwa mittels steuerlicher Vorteile (siehe oben). Mehr Ältere in Beschäftigung zu halten wird dabei als wesentlicher Beitrag zur Lösung von Fachkräfteengpässen betrachtet (siehe hier).
In vielen Betrieben gibt es Beschäftigte im Rentenalter (siehe hier). Umfragen unter Personalverantwortlichen weisen jedoch darauf hin, dass der Verbleib oder gar die Neueinstellung älterer Beschäftigter oft kritisch gesehen werden, etwa aufgrund von (antizipierten) zunehmenden gesundheitlichen Problemen im Alter oder gewandelten Fähigkeiten (siehe z. B. hier). In Bezug auf betriebliche Einstellungs- und Personalpolitiken geben ältere Personen entsprechend oft an, geringere Wertschätzung und stärkere Diskriminierung erfahren zu haben (siehe hier, hier und hier).
Das Beschäftigungsklima für diese Gruppe hat sich zudem jüngeren Befragungen zufolge verschlechtert, u. a. bedingt durch vermeintliche Generationenkonflikte: Obwohl die Vorteile strategisch gemanagter altersgemischter Teams gut belegt sind (siehe hier), bleiben Altersstereotype in Betriebskulturen nach wie vor tief verankert (siehe z. B. hier). Darüber hinaus ist die Situation Älterer im Betrieb insgesamt u. a. durch geringere Aufstiegschancen, verminderte Weiterbildungsbeteiligung und geringere Gesundheitschancen geprägt (siehe hier).
Deller und Naegele (2023) konstatieren entsprechend: „Fraglich ist auch, inwieweit im Ruhestand überhaupt von alterssensiblen Arbeitsumwelten ausgegangen werden kann, wenn diese vielerorts kaum für ältere Erwerbstätige vor dem Ruhestand umgesetzt zu werden scheinen. Vor diesem Hintergrund ist zu befürchten, dass bereits bestehende Chancenungleichheiten im höheren Erwerbsalter in den Ruhestand übertragen werden, sich dort verfestigen und neue soziale Ungleichheiten produzieren.“ (siehe hier, S. 347f.).
So kommt auch nicht unerwartet, dass viele ältere Beschäftigte einen frühen Renteneintritt anstreben, insbesondere – aber nicht nur – in hochbelasteten Berufen (siehe hier). Neben der Reduktion individueller Beanspruchung im Job verbinden viele damit den Wunsch nach mehr Zeit für sich selbst. Das zeigt: Für ein Weiterarbeiten über den Renteneintritt hinaus ist es notwendig, ein „Älterwerden im Betrieb“ für alle Altersgruppen zu ermöglichen, das bereits während der Erwerbsphase hinreichend (lebensphasengerechte) Zeitverfügbarkeit gewährleistet und einen belastungsinduzierten Dropout durch alternsgerechte Arbeitsbedingungen verhindern kann (siehe auch hier).
Leistungsgewandelte und (schwer-)behinderte Personen
Und wie steht es um die betriebliche Integration von Personen, die etwa aufgrund von Krankheit oder Unfall leistungsgewandelt, leistungsgemindert oder gar (schwer-)behindert sind? Auch hier werden in der Literatur immer wieder große Erwerbspotenziale angemerkt (siehe z. B. hier) – im Falle Schwerbehinderter besteht sogar eine Verpflichtung zur Beschäftigung der Betroffenen (siehe hier). Darüber hinaus sind unterstützende Maßnahmen vorgesehen, die Einstiege und Verbleib im Betrieb erleichtern sollen (z. B. Betriebliche Wiedereingliederung und Unterstützte Beschäftigung auf individueller oder Eingliederungszuschüsse auf betrieblicher Seite).
Das Beschäftigungspotenzial der Schwerbehinderten wird offenkundig nur in geringem Maße ausgeschöpft: Das zeigt sich u. a. daran, dass im Jahr 2024 nur knapp 40 Prozent der infrage kommenden Betriebe ihrer gesetzlichen Pflicht zur Beschäftigung dieser Personengruppe vollständig nachgekommen sind und rund ein Viertel der betreffenden Betriebe ihrer Verpflichtung in keiner Weise gerecht geworden ist (siehe hier). In den meisten Betrieben in Deutschland, die zur Beschäftigung von (schwer-)behinderten Personen verpflichtet sind, werden Ausgleichs- und Strafzahlungen in Kauf genommen (im Jahr 2020 insgesamt 697 Millionen Euro, siehe hier). Die Umsetzung von Maßnahmen, die Betrieben eine Integration entsprechender Kräfte vor Ort erleichtern sollen, bewegten sich auf insgesamt niedrigem Niveau, wie sich etwa am Beispiel der Unterstützten Beschäftigung feststellen lässt (siehe hier).
Auch die betrieblichen Voraussetzungen zur Beschäftigung Betroffener, wie etwa angepasste Arbeitsbedingungen und umfassende Gefährdungsbeurteilungen für Personen mit besonderem Schutzbedarf, werden nicht geschaffen (siehe u. a. hier). In vielen Betrieben fehlt dazu das relevante Wissen (siehe hier). Allerdings sind grundlegende Arbeitsschutzmaßnahmen auch „unterhalb“ der komplexeren Anforderungen etwa im Falle von Schwerbehinderung noch immer nicht flächendeckend umgesetzt (siehe hier).
Neben (schwer-)behinderten Personen sind auch Beschäftigte, die längerfristig oder chronisch erkrankt sind, eine vulnerable Gruppe, die häufig Nachteile bei Rückkehr und Reintegration an den Arbeitsplatz erfährt. Auch Sie sind von Stigmatisierung und Stereotypisierung betroffen: So bestehen vielfach Bedenken hinsichtlich ihrer künftigen Leistungsfähigkeit oder Eignung, bestimmte Tätigkeiten auszuführen (siehe zusammenfassend hier).
Neben sozialen Problemen beim Wiedereinstieg und Abwertungserfahrungen sind Betroffene häufig auch mit inadäquater Beschäftigung konfrontiert, wenn sie aus Krankheit oder Therapie an den Arbeitsplatz zurückkehren (siehe u. a. hier). Gut belegt ist auch, dass Betroffene ihre Inklusion als unzureichend erleben, begleitet von Diskriminierungserfahrungen, Angst vor Benachteiligung sowie verminderter Arbeitszufriedenheit (siehe zusammenfassend hier).
Für eine inklusionsfreundliche Unternehmenskultur bedarf es kaum innovativer Gestaltungskonzepte. Vielmehr geht es um die konsequente Umsetzung von Vorgaben, die sich bereits in Arbeits-, Betriebsverfassungs- und Antidiskriminierungsgesetzen finden, wie etwa Gefährdungen am Arbeitsplatz regelmäßig zu prüfen und diese Prüfungen zu dokumentieren, Quoten umzusetzen, AGG-Beschwerdestellen einzurichten, Vertrauensleute zu benennen oder Schwerbehindertenvertretungen wählen zu lassen. Vertrauensvolle Kommunikation, Offenheit im Umgang mit Belastung und Krankheit sowie eine Potenzial- statt Defizitorientierung in der Personalführung können weitere hilfreiche Bausteine sein (siehe z. B. hier).
Fazit
Diese exemplarische Auswahl mag bereits ausreichen, um die oftmals prekäre Situation von Belegschaftsteilen zu illustrieren, die nicht oder nur eingeschränkt der sog. „Ideal Worker Norm“ entsprechen. Damit wird auch klar, wie unzureichend die Ausschöpfung und Aktivierung von Beschäftigungspotenzialen in der Erwerbsbevölkerung verläuft – gleichwohl sie nicht nur aufgrund der sozialpolitischen Zielsetzung einer gleichberechtigten Erwerbsteilhabe aller Personengruppen, sondern auch zur Schließung von Fachkräftelücken geboten ist.
Es ist ein Mythos, dass für eine angeblich unzureichende Erwerbsbeteiligung das Fehlen von gesetzlichen Rahmenbedingungen oder der oft kolportierte Unwille von Beschäftigten ursächlich ist (siehe auch bereits hier sowie zur aktuellen Diskussion um „Lifestyle-Teilzeit“ z. B. hier). Die empirischen Befunde zeigen stattdessen, dass vor allem die Gestaltung der Arbeit im Betrieb bedeutend ist: Beschäftigungspolitische Anreize bringen wenig, wenn in Unternehmen nicht die Voraussetzungen dafür bestehen und keine oder eine nur marginal ausgeprägte Gleichstellungs-, Alters- und Inklusionskultur vorherrscht. Mehr noch: Wenn bestimmte Personengruppen keine guten Arbeitsbedingungen vor Ort erwarten können oder sogar Nachteile antizipieren müssen, dürfen an sie keine Erwartungen für Berufseintritte, Rückkehr oder Stundenaufstockung gerichtet werden.
Für diversitätsfreundliche Bedingungen vor Ort zu sorgen ist freilich nicht voraussetzungslos. Auch können sicher nicht alle strukturellen Hemmnisse für eine gesteigerte Erwerbsbeteiligung auf betrieblicher Ebene gelöst werden; so gehören auch institutionelle Rahmenbedingungen dazu – wie z. B. die Abschaffung des Ehegatten-Splittings, das ebenfalls Geschlechterungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt zementiert (siehe zusammenfassend hier).
Beispiele guter Diversitätspraxis (siehe z. B. hier und hier) zeigen jedoch, dass man im Betrieb nicht zwingend auf entsprechende Gesetzesinitiativen bzw. -änderungen warten muss. Arbeit gut und gesund sowie altersgerecht zu gestalten, Handlungsspielräume und flexible Arbeitszeiten anzubieten, Entgeltgleichheit zu realisieren usw. sowie entsprechende Maßnahmen etwa in Form von Betriebsvereinbarungen festzuschreiben – das alles ist im bereits bestehenden Zusammenspiel von tariflichem und rechtlichem Rahmen möglich und bedarf keiner weiteren institutionellen Voraussetzungen (siehe z. B. hier).
* An dieser Stelle nicht genannt werden weitere vulnerable Gruppen, wie etwa Menschen mit Migrationsgeschichte, ausländische Saisonarbeitskräfte oder queere Menschen uvm., die im betrieblichen Arbeitssetting ebenso häufig im Gegensatz zu überwiegend homogen geprägten Kernbelegschaften weniger privilegiert erscheinen (siehe z. B. hier, hier und hier). Besonders problematisch ist darüber hinaus, wenn Personen von Mehrfachvulnerabilität betroffen sind, z. B. (schwer-)behinderte Frauen (siehe hier). Selbstverständlich gibt es auch diverse Gruppen, die der „Ideal-Worker-Norm“ durchaus entsprechen können, z. B. qualifizierte zugewanderte Personen. Wenngleich sie damit prinzipiell Anforderungen der betrieblichen Verwertungslogik erfüllen, werden sie nicht selten auf andere Weise marginalisiert und diskriminiert, etwa durch Alltagsrassismus (siehe z. B. hier).
Zurück zum WSI-Blog Work on Progress
Die Beiträge der Serie
- Florian Blank/Jutta Schmitz-Kießler/Eike Windscheid-Profeta: Mythen der Sozialpolitik: Eine Blogserie (30.07.2024)
- Camille Logeay/Florian Blank: Das Generationenkapital – alle profitieren? (30.07.2024)
- Jennifer Eckhardt: Von wegen Hängematte: Zur Unzugänglichkeit von Sozialleistungen (01.08.2024)
- Dagmar Pattloch: Das Zugangsalter in die Rente der Deutschen Rentenversicherung Bund. Eine Richtigstellung (08.08.2024)
- Johannes Geyer: Die Grundrente: Was ist das eigentlich? (15.08.2024)
- Eileen Peters/Yvonne Lott: Die unbezahlte Doppelbelastung: Warum Frauen nicht noch mehr arbeiten können (22.08.2024)
- Jutta Schmitz-Kießler: Hartnäckig, aber falsch: Die Kritik an der Bürgergelderhöhung (30.08.2024)
- Eike Windscheid-Profeta: Jung, faul, wehleidig: Hat die „Gen Z“ den Generationenvertrag gekündigt? (04.09.2024)
- Ingo Schäfer: Die Wahrheit: Warum Bundeszuschüsse zur Rentenversicherung richtig sind (27.09.2024)
- Nina Weimann-Sandig: Betreuungskrise: Warum mehr Stunden nicht helfen (04.10.2024)
- Andreas Jansen: Nein! Die Rentenangleichung ist nicht für alle Menschen in Ostdeutschland von Vorteil (29.11.2024)
- Eike Windscheid-Profeta: Krankheitsbedingte Fehlzeiten: Zwischen Bettkanten und dünnen Personaldecken (13.12.2024)
- Johannes Steffen: Die Bürgergeld-Reform von 2023 – Quelle allen Übels? (04.02.2025)
- Michaela Evans-Borchers/Christoph Bräutigam: Zukunft der Pflege: „Die“ Pflege gibt es nicht! (07.02.2025)
- Eike Windscheid-Profeta: Arbeitsvolumen in Deutschland: (Wieder) mehr und länger arbeiten für Wohlstand und Wohlfahrt? (07.04.2025)
- Magnus Brosig: Faire Haltelinie: Warum ein dauerhaft stabiles Rentenniveau sinnvoll und gerecht ist (14.04.2025)
- Reinhold Thiede: Umlagefinanzierte Alterssicherung funktioniert – auch wenn die Bevölkerung altert (24.04.2025)
- Manuel Schmitt: Vermögensteuer? Geht! Die Schweiz widerlegt den Mythos vom Unmöglichen (14.05.2025)
- Heinz Rothgang: Mythen in der Pflegeversicherung (22.05.2025)
- Eike Windscheid-Profeta: Alt, krank, weiblich: Abwertung im Betrieb verhindert die Ausschöpfung von Erwerbspotenzialen (05.02.2026)
weitere Beiträge in Vorbereitung
Zentrale Thesen und Argumente im Überblick
„Oft gehört, trotzdem falsch" Magazin Mitbestimmung Ausgabe 02/2025
Interview zur Blogserie
„Wir wollen Unwahrheiten etwas entgegensetzen” Magazin Mitbestimmung Ausgabe 02/2025
Autor
Dr. Eike Windscheid-Profeta leitet das Referat Wohlfahrtsstaat und Institutionen der Sozialen Marktwirtschaft in der Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung.